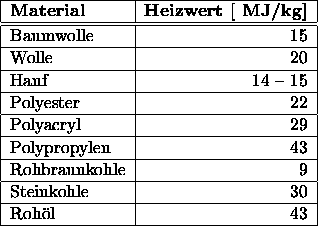Next: Ökologische Kleidung
Up: Probleme mit der Kleidung
Previous: Umweltbelastungen durch Reinigung und
Die Entsorgung von gebrauchten Produkten kann theoretisch auf verschiedenen
Wegen geschehen. Entweder werden sie in die Stoffkreisläufe
zurückgeführt
oder als Abfall entsorgt. Die
Rückführung kann aus einer
Weiterverwendung des Produktes bestehen (Altkleidersammlung,
Second-Hand-Läden ),
der Verwertung einzelner Bestandteile für gleiche,
gleichwertige oder minderwertige Produkte (Downcycling) oder
der Zerlegung in Rohstoffe, die dann zur
Herstellung eines gleichen oder anderen Produktes verwendet werden können
(Recycling) . Im Zusammenhang mit der
Altkleidersammlung ergeben sich Probleme aufgrund der Menge an abgelegter
Kleidung. Vielfach werden Altkleider in Entwicklungsländer exportiert und
verdrängen deren heimische Textilindustrie. In jüngerer Zeit wurde
entdeckt, daß Kleidersammlungen zwar unter dem Namen karitativer Verbände
durchgeführt werden, die Kleider aber an kommerzielle Händler gelangen
und in deren Second-Hand-Läden verkauft werden
des Produktes bestehen (Altkleidersammlung,
Second-Hand-Läden ),
der Verwertung einzelner Bestandteile für gleiche,
gleichwertige oder minderwertige Produkte (Downcycling) oder
der Zerlegung in Rohstoffe, die dann zur
Herstellung eines gleichen oder anderen Produktes verwendet werden können
(Recycling) . Im Zusammenhang mit der
Altkleidersammlung ergeben sich Probleme aufgrund der Menge an abgelegter
Kleidung. Vielfach werden Altkleider in Entwicklungsländer exportiert und
verdrängen deren heimische Textilindustrie. In jüngerer Zeit wurde
entdeckt, daß Kleidersammlungen zwar unter dem Namen karitativer Verbände
durchgeführt werden, die Kleider aber an kommerzielle Händler gelangen
und in deren Second-Hand-Läden verkauft werden .
.
Eine Entsorgung als Abfall geschieht entweder durch energetische (thermische)
Verwertung, durch Kompostierung
oder Deponierung [13].
Eventuell in der Kleidung noch enthaltene Reststoffe aus der Ausrüstung
können dadurch in die Umweltkompartimente Wasser und Boden gelangen.
Das Abfallgesetz [20] setzt die
Prioritäten für die Abfallbehandlung in der
Reihenfolge:
- Vermeiden,
- Verwerten, (stofflich, d. h. Rückführung in Stoffkreisläufe)
- Verwerfen (Entsorgung).
Aus dogmatisch-ökologischer Sicht ist ein Vermeiden vorzuziehen, da
dadurch Stoff- und Energieströme
reduziert werden. Jedoch ist die Vermeidung von Abfällen in der
Konsumgesellschaft meistens nicht
praktizierbar, da der Konsum den Verbrauch von Produkten
beinhaltet und nur so eine Neuproduktion nach sich zieht. Die grundsätzliche
Vermeidung von Abfall kann also nicht gefordert werden, ohne den
strukturellen Aufbau der westlichen Gesellschaft in Frage zu stellen.
Daher ist in jedem Einzelfall eine Abwägung von Vor- und
Nachteilen der jeweiligen Abfallbehandlung vorzunehmen und nach deren
Ergebnis die Entscheidung über Vermeiden, Verwerten oder Verwerfen
zu treffen.
Ein Recycling von Produkten ist ökologisch nur
sinnvoll, wenn der Energieverbrauch , die
Emissionen und der
Rohstoffverbrauch dazu geringer
ausfallen als bei der Neuherstellung des Produktes. Die Voraussetzungen für
ein Recycling sind demzufolge:
- sortenreine Produkte,
- saubere Produkte,
- ein geringerer Energieverbrauch als bei Neuherstellung,
- keine Eigenschaftseinbußen beim rezyklierten Material,
- daß das Material einen geringen Heizwert hat und
- die Deponierung oder Verbrennung des Produktes erhebliche
Risiken für Umwelt und/oder Gesundheit bedeuten.
Die grundlegende Forderung bei der Entscheidung für ein Produktrecycling
ist daher stets, daß der gesamte
Aufwand für die Wiederherstellung des stofflichen Ausgangszustandes
eines Produktes deutlich niedriger sein muß, als der für
die ursprüngliche Bereitstellung der Stoffe [13].
Auf dem Textil- und Bekleidungssektor ist in aller Regel ein
Downcycling bzw. eine thermische Verwertung
der Altkleider vorzufinden.
Das jährliche Abfallaufkommen an textiler
Bekleidung wird für die
Bundesrepublik auf etwa 600.000 Tonnen geschätzt, von denen ein Drittel
von den Altkleidersammlungen erfaßt werden
und zwei Drittel in den Haus- und Sperrmüll
gelangen [18].
Die gesammelten Textilien sind meistens nicht sortenrein und können nur
unter erheblichem Aufwand voneinander getrennt werden. Zudem sind sie
in aller Regel mit Textilhilfsmitteln
und/oder Farbstoffen versehen, die sich kaum
entfernen lassen.
Sofern die Sortenreinheit gegeben ist, läßt sich aus Altkleidern auf
Zellulosebasis Viskose herstellen. Die zum Aufschluß der Kleider nötige
Energie ist in etwa gleich groß wie beim Zelluloseaufschluß aus Holz
[13]. Bei sortenreinem Polyester
ist das Einschmelzen ebenfalls möglich: Die Firma Gore hat eine
Produktlinie entwickelt, die nur aus Polyester und der wasserdichten
PTFE-Membran besteht. Nach dem Gebrauch kann die Bekleidung an den
Hersteller zurückgegeben werden, der die Bestandteile mechanisch
voneinander trennt . Während die Membran echt rezykliert wird, kann aus
dem Polyestermaterial in einem Downcycling-Prozeß nur ein
minderwertigeres Produkt hergestellt werden.
. Während die Membran echt rezykliert wird, kann aus
dem Polyestermaterial in einem Downcycling-Prozeß nur ein
minderwertigeres Produkt hergestellt werden.
Ein anderer Ansatzpunkt wird von dem Hersteller Malden Mills verfolgt:
Der Großteil der produzierten Polyester-Fleece-Bekleidung ist aus
rezykliertem Material mit einem Gewichtsanteil von bis zu 95 Prozent.
Das Ausgangsmaterial soll hauptsächlich aus ehemaligen Getränkebehältern
bestehen.
mit einem Gewichtsanteil von bis zu 95 Prozent.
Das Ausgangsmaterial soll hauptsächlich aus ehemaligen Getränkebehältern
bestehen.
Der energetische und damit auch finanzielle Aufwand
zum Trennen und Aufschließen der Altkleidung
steigt mit der Anzahl der voneinander zu trennenden Gemischbestandteile,
was sich mit Hilfe der Gesetze der Thermodynamik
(Entropiezunahme, Unordnung) leicht nachvollziehen läßt.
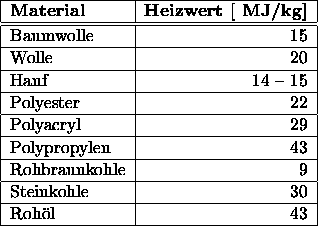
Tabelle: Heizwerte von
Textilrohstoffen im Vergleich zu fossilen Energieträgern.
Quelle: [2, 13, 21]
Besonders bei der Betrachtung der Heizwerte von Bekleidungsrohstoffen im
Vergleich zu fossilen Energieträgern wird daher die thermische Verwertung
von Alttextilien interessant. Eine moderne Brenn- und Filtertechnologie
auf dem Stand der Technik vorausgesetzt, kann die schadstoffarme
Verbrennung von Alttextilien durchaus ökologisch sinnvoll sein: Je nach
Material kann Erdöl zur Energiegewinnung bis
zur gleichen Höhe der entsprechenden Masse eingespart werden
(s. Tab.  ).
).
Die Kompostierung von Bekleidung liefert im
Gegensatz zur Verbrennung in der Regel keine nutzbare Energie,
emittiert aber die gleiche Menge an CO  [13]. Zudem ist sie mit einem erheblichen
Platzbedarf verbunden.
Sofern die zu kompostierenden Stoffe keine zu hohen Gehalte an
Textilchemikalien haben, kann zumindest
der entstehende Kompost als Dünger
genutzt werden.
[13]. Zudem ist sie mit einem erheblichen
Platzbedarf verbunden.
Sofern die zu kompostierenden Stoffe keine zu hohen Gehalte an
Textilchemikalien haben, kann zumindest
der entstehende Kompost als Dünger
genutzt werden.
Die energetische Alternative zur Verbrennung ist die Gewinnung von Biogas
aus der Kleidung. Dabei ensteht ein Gas, daß sich zu
65 Prozent aus Methan und zu 35 Prozent aus Kohlendioxid
zusammensetzt. Bei der Verbrennung des Gases
entsteht genauso viel CO  wie bei der
kompletten Verbrennung der Kleider. Solange ein aerober Abbau
stattfindet,
entspricht die Biogasgewinnung bezüglich der CO
wie bei der
kompletten Verbrennung der Kleider. Solange ein aerober Abbau
stattfindet,
entspricht die Biogasgewinnung bezüglich der CO  -Emission daher einer
Verbrennung der Kleider mit zeitlicher Verzögerung. Bei anaerobem Abbau
und einem ungenutzten Entweichen des
entstehenden Methans in die Atmosphäre, wirkt dieses
hingegen als 20-fach wirksameres Treibhausgas als
Kohlendixoid [13].
-Emission daher einer
Verbrennung der Kleider mit zeitlicher Verzögerung. Bei anaerobem Abbau
und einem ungenutzten Entweichen des
entstehenden Methans in die Atmosphäre, wirkt dieses
hingegen als 20-fach wirksameres Treibhausgas als
Kohlendixoid [13].





Next: Ökologische Kleidung
Up: Probleme mit der Kleidung
Previous: Umweltbelastungen durch Reinigung und
Kai Altenfelder
Sat Jul 11 00:38:57 MET DST 1998 
 des Produktes bestehen (Altkleidersammlung,
Second-Hand-Läden ),
der Verwertung einzelner Bestandteile für gleiche,
gleichwertige oder minderwertige Produkte (Downcycling) oder
der Zerlegung in Rohstoffe, die dann zur
Herstellung eines gleichen oder anderen Produktes verwendet werden können
(Recycling) . Im Zusammenhang mit der
Altkleidersammlung ergeben sich Probleme aufgrund der Menge an abgelegter
Kleidung. Vielfach werden Altkleider in Entwicklungsländer exportiert und
verdrängen deren heimische Textilindustrie. In jüngerer Zeit wurde
entdeckt, daß Kleidersammlungen zwar unter dem Namen karitativer Verbände
durchgeführt werden, die Kleider aber an kommerzielle Händler gelangen
und in deren Second-Hand-Läden verkauft werden
des Produktes bestehen (Altkleidersammlung,
Second-Hand-Läden ),
der Verwertung einzelner Bestandteile für gleiche,
gleichwertige oder minderwertige Produkte (Downcycling) oder
der Zerlegung in Rohstoffe, die dann zur
Herstellung eines gleichen oder anderen Produktes verwendet werden können
(Recycling) . Im Zusammenhang mit der
Altkleidersammlung ergeben sich Probleme aufgrund der Menge an abgelegter
Kleidung. Vielfach werden Altkleider in Entwicklungsländer exportiert und
verdrängen deren heimische Textilindustrie. In jüngerer Zeit wurde
entdeckt, daß Kleidersammlungen zwar unter dem Namen karitativer Verbände
durchgeführt werden, die Kleider aber an kommerzielle Händler gelangen
und in deren Second-Hand-Läden verkauft werden .
.