Der Anbau von Hanf ist in der ganzen
gemäßigten Zone , im
Mittelmeergebiet und in den Subtropen möglich. Er benötigt allerdings mehr
Sonne und Wärme als beispielsweise der Lein . Am besten
gedeiht Hanf in gemäßigten, feuchten Klimata bei Temperaturen
von 13 ![]() bis 22
bis 22 ![]() C. Er verträgt
sowohl niedrigere als auch höhere Temperaturen.
Junge Pflanzen überstehen sogar leichten Nachtfrost
(-3 bis -5
C. Er verträgt
sowohl niedrigere als auch höhere Temperaturen.
Junge Pflanzen überstehen sogar leichten Nachtfrost
(-3 bis -5 ![]() C) [41].
C) [41].
Hanf stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und ist als Pionierpflanze auch auf Grenzertragsböden kultivierbar. Für einen optimalen Ertrag sollte der Boden aber tiefgründig, humos, kalkhaltig, stickstoffreich und im pH-Wert neutral bis leicht basisch sein. Gut geeignet sind nährstoffreiche Flußtäler und entwässertes Moorland, nicht geeignet sind arme Sandböden, schwere Tonböden und alle an stauender Nässe leidende Böden [41].
Zur Fasergewinnung werden monözische Sorten vorgezogen, da bei ihnen männliche und weibliche Pflanzen gleichzeitig reifen und so der Erntetermin leichter zu bestimmen ist. Faserhanf wird in Reihen von 15 - 17 cm Abstand und mit einer Saatstärke von 55 - 70 kg/ha ausgesäht.
Aufgrund seiner Schnellwüchsigkeit (20 - 40 cm pro Woche) und der guten Jugendentwicklung mit hohem Konkurrenzpotential ist in der Regel keine Unkrautentwicklung festzustellen. Der Einsatz von Pestiziden ist deshalb nicht nötig. Hanf eignet sich dadurch in besonderem Maße für eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft (sustainable agriculture and rural development) [21, 43, 11].
Die Vegetationsperiode dauert beim Hanf etwa 100 Tage und ist mit der von Lein und Raps vergleichbar. Der Arbeitsaufwand für die Bestellung der Felder wird aufgrund der nicht nötigen Unkrautbehandlung in der Literatur [44] mit der Hälfte des für Baumwolle nötigen Aufwandes angegeben.
Der Nährstoffbedarf des Hanfes ist wegen seiner Schnellwüchsigkeit relativ
hoch. In den verschiedenen Quellen werden unterschiedlich große Mengen an
benötigtem Mineraldünger angegeben
(s. Tab.  ).
).
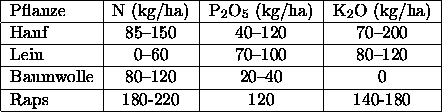
Tabelle:
Der Düngerbedarf von Hanf und einigen ausgewählter Nutzpflanzen
Quelle: [21, 11]
Im Braunschweiger Institut für Pflanzenbau der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) wurden Anbauversuche zum Stickstoffbedarf und Bestandesdichte durchgeführt. Für den praktischen Anbau wurden Stickstoffdüngergaben von 60 - 100 kg pro Hektar als ausreichend befunden. Damit liegt Hanf im Stickstoffbedarf niedriger als andere landwirtschaftlich genutzte Pflanzenarten. Allerdings zeigt Hanf sich bei einer Stickstoffmangelversorgung ebenso empfindlich wie bei Kupfermangel . Im Gegensatz zu den meisten anderen Kulturpflanzen sind dies aber die einzigen, ihn limitierenden Ernährungsstörungen [21]. Bei zu starker Düngung wachsen die Pflanzen zu schnell und können wegen der noch ungenügender Verholzung im Sturm oder durch Hagel umknicken. Hanf, der zu stark gedüngt wurde und eine Länge von über 250 cm aufweist, ist für die Fasergewinnung nicht geeignet [21]. Diese beiden Umstände sorgen wirkungsvoll dafür, daß nicht mit dem Ziel einer vermeintlichen Ertragssteigerung zu hohe Düngergaben ausgebracht werden.
Der flächenbezogene Trockenmasseertrag von Hanf wird in den Anbauversuchen mit 10 - 20 Tonnen pro Hektar angegeben, der Faserertrag mit 2 - 5 t/ha [43]. Der weltweite durchschnittliche Hektarertrag an Fasern wird von der FAO (Food and Agriculture Organization) mit 400-5700 kg/ha beziffert [21].
Die Hanfpflanze hat einen hohen Wasserbedarf. Bei
den Anbauversuchen der FAL lag die natürliche bzw. künstlich
während der Vegetationsperiode eingestellte
Niederschlagsmenge zwischen 307 und 381 mm/m ![]() . Im niederschlagsarmen
Spanien wurde bis zu 10.000 m
. Im niederschlagsarmen
Spanien wurde bis zu 10.000 m ![]() /ha bewässert (= 1000 mm/m
/ha bewässert (= 1000 mm/m ![]() )
[21].
)
[21].
Schädlinge wurden im Anbauversuch nicht festgestellt. Aus der Literatur sind als parasitäre Samenpflanzen :
bekannt. Der Befall kann wirkungsvoll durch eine gründliche Saatgutreinigung , Kalidüngung oder die Verwendung resistenter Sorten vermieden werden [21]. Tierische Schädlinge sind selten und treten nur vereinzelt auf, die wichtigsten sind [21]:
,,In der älteren Literatur wird über einige Pilzkrankheiten (z. B. Fußkrankheiten, Mehltau, Fusariosen ) und unspezifische tierische Allgemeinschädlinge (Drahtwurm, Larven der Wiesenschnake) berichtet`` [45].